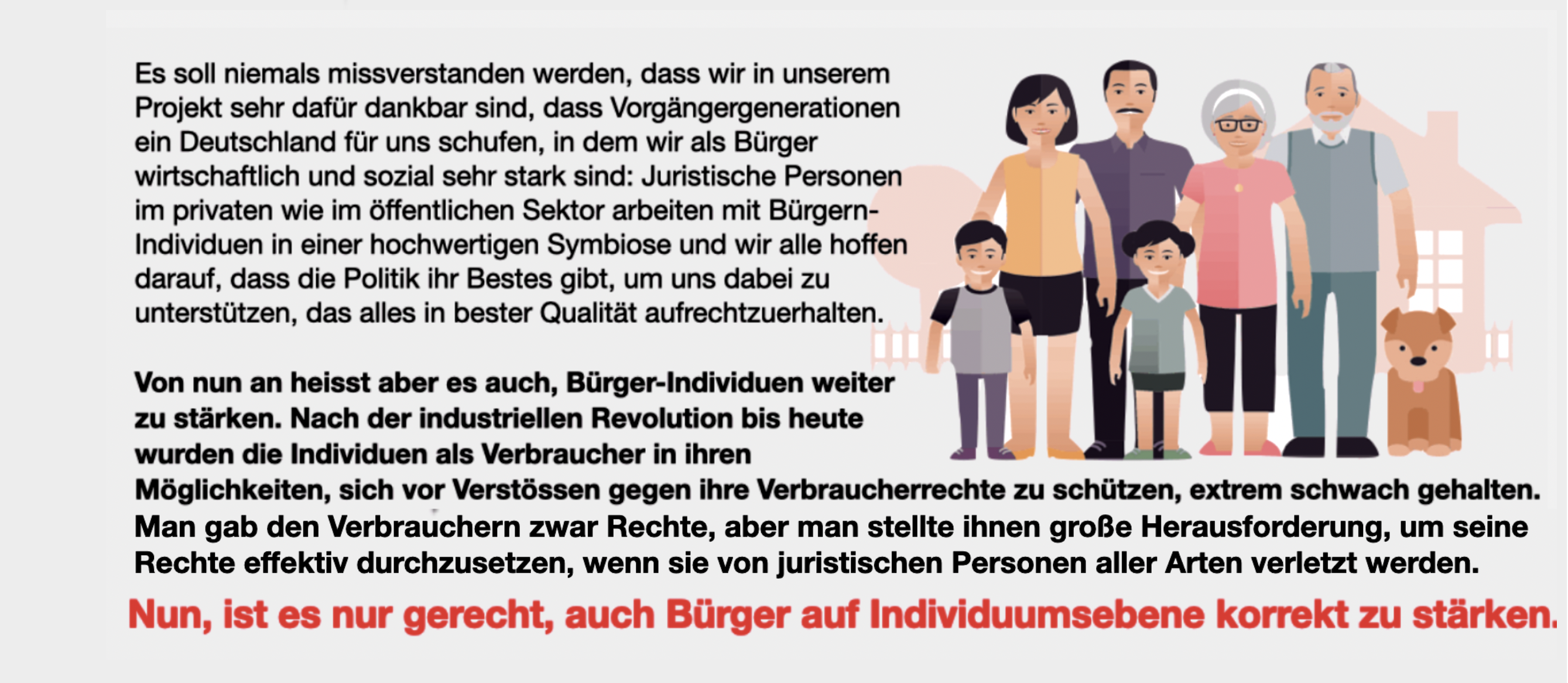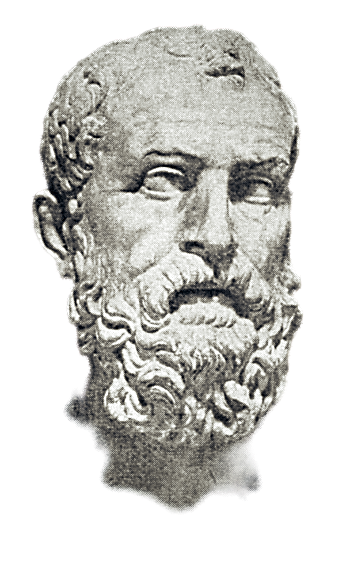
Dieser Text hier erzählt sehr minimal die Geschichte der Entstehung der Demokratie, wie wir sie heute kennen. Aber er ist ein Ansporn für Ihre eigene Researche darüber, wenn Sie wirklich tief in diese faszinierende Geschichte der Menschheitsentwicklung eintauchen möchten. Ich erzähle hier ganz allgemein, so dass auch der in dieser Materie ganz unbelesene Mitbürger es ausreichend begreift, was Demokratie ist. Diese Kenntnisgrundlage genügt es dafür, das Buerger-Individuum-Projektziel nachzuvollziehen und dafür im Rahmen der deutschen Demokratie und der deutschen Volkssoveränität zu argumentieren.
Die UR-Menschen und der Drang nach Gemeinschaftsbildung
Die Ur-Menschen haben auch wie andere Tierarten schon immer die Bildung von Gruppen (Ruddel) mit anderen Ur-Menschen gesucht. Gemeinsam konnte man sich besser vor Gefahren schützen, besser jagen, das Fleisch ins Wohnlager mitnehmen und dort so zubereiten und lagern, wie man es zum Beisiel für die Überwinterung brauchte. Gemeinsam zu handeln, war bereits damals für die Menschen von sehr großem Wert. Mit der Zeit wuchsen die Gruppen sie gesellten sich zueinander, formten Interessensgemeinschaften. Grosse Gruppen von Ur-Menschen bedeuteden Macht auch für andere kleineren Menschengruppen. Gruppen von Menschen haben schon damals miteinander rivalisiert, genauso, wie die Tieren. Es ging ums Überleben, um geographische Lageverteidigung, geographische Ansprüche auf besser zu überlebenede Lage anderer Gruppen, es ging auch um die eigene Machtansrprüche innerhalb der Gruppe, etc.. Innerhalb der Gruppen mussten Entscheidungen getroffen werden, die weitestgehend alle zufrieden stellen konnte, weshalb sie einen Anführer aussuchten und ihn für die Führungsaufgabe bestimmten, sie brauchten einen weisen Patriarch, der für Ordnung und die Schaffung von Regeln für das Zusammenleben zuständig war. Später im Verlauf der Epochen wurde aus der Figur des Patriarchs ein König.
Die Ur-Menschen und die Entdeckung der Intelligenz
Die menschiche Intelligenz brachte das Tier Mensch sich anderes zu entwickeln als die Tiere ohne vergleichbare Intelligenz. Da die Menschen damals in der Zeit der Ur-Menschen noch nicht so weit waren, Wissen als Wissen zu erfassen, es methodisch verständlich aufzuschreiben und es auch so zu nutzen, um Lösungen für ihr Leben zu nutzen, glaubten sie an eine außermenschliche Kraft, die für den Regen, Blitz, Donner, Hochwasser, Dürre, etc.alles, was sie nicht kannten und nachahmen konnten, zuständig war. Später, als die Ur-Menschen sich selbst zu beobachten anfingen, entdeckten sie das Potential ihrer eigenen Intelligenz, sie fingen an, dieses Potential zu nutzen, um Instrumente zu bauen, miteinander zu verhandeln, Beobachtungen aufzumalen, sie aufzuschreiben, entwickelten wachsendes Vergangenheitsbewusstsein, etc.. Und ungefähr so formte sich die Zivilisation aus der Gruppe von Menschen, die ähnliche Interessen hatten und danach lebten. Die Gruppen entwickelten sich unterschiedlich aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten, Gruppenbedürfnisse, ihrer geographischen Lage und ihrer Form der Gestaltung des Miteinanders. Alle gemeinsam entwickelten und benutzten Instrumente, Waffen, Wissen, u.a. Lug und Trug, sowie Vernunft und Wohlwollen, um ihre Ziele in der Gruppe und in der Beziehung zu anderen Gruppen zu erreichen.
Allein der Mensch verfüge nämlich über Wahrnehmung (aísthēsis) von einigen begrifflichen Gegensatzpaaren,
nämlich des Guten (agathón) und des Schlechten (kakón), des Nützlichen (symphéron) und des Schädlichen (blaberón), des Gerechten (díkaion) und des Ungerechten (ádikon). Das gemeinschaftliche Leben aufgrund dieser Begriffe (hē toútōn koinōnía) führe zur Bildung des Hauses und der Polis bzw. bringe diese zustande (poieî oikían kaì pólin), d.h. dadurch entstehen größere [Königreich, Kaiserreich, Zarenreich, etc.], die mehrere Menschen umfassen (Aristoteles, Politik I 2, 1253a7-18 und besonders: 14-18).
Die Zeit verging und ungefähr dort, wo wir heute als die Region des ägaischen Meers und Mittelmeers kennen, gab es viele Gruppen von Menschen jeweils mit einem „König“. Es gab kein großes Königreich, stattdessen gab es viele kleine Stadt-Staaten, die alle politisch unabhängig voneinander waren. Diese Stadt-Staaten wurden Polis genannt und die größte unter ihnen war Athen oder Attika.
Wer schon auf Kreta war und die Ruinen von Knossen besichtigt hat, konnte auf dem Boden sein, in dem das Zusammenleben in pre-demokratischer Form stattfand. Die Bildung der Polis, als Entstehung und Festigung eines Staatswesens, erfolgte im Anschluss an die kretisch-mykenische Palastkultur und die „Dark Ages“ ab dem 8. Jahrhundert.
Bereits zu diese Zeit, in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr., beklagte Theognis von Megara die unsicheren Besitzverhältnisse einer Verkehrs- und Geldwirtschaft, die sehr schnell aus Reichen Arme macht und umgekehrt (Ste. Croix 1989: 279). Die traditionellen, hierarchiebestimmten Herrschaftsverhältnisse werden durch die Eigenart der Marktwirtschaft, kein Ansehen der Person zu kennen, unterminiert. Weber stellte Ähnliches fest: „Wo der Markt seiner Eigengesetzlichkeit überlassen ist, kennt er nur Ansehen der Sache, kein Ansehen der Person, keine Brüderlichkeits- und Pietätspflichten, keine der urwüchsigen, von den persönlichen Gemeinschaften getragenen menschlichen Beziehungen“ (Weber 1976: 383).
Es ist kein Wunder, dass Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) seine 8 Bände „Politik“ geschrieben hat und darin für die „Politie“plädierte, eine Art Volksherrschaft, in der die Vernünftigen und Besonnenen das Sagen haben. Mehr dazu etwas weiter unten.
Griechenland in der archaischen Zeit, 800–500 v. Chr.
Die Epoche um ca. das Jahr 800–500 v. Chr. nennt man archaische Zeit und wir sprechen von nun an über die Entwicklung der Menschheit in diesem Raum, das wir einfach Griechenland in der archaischen Zeit nennen. Die Anfänge der Polis-Organisation, also, der Stadtstaaten nimmt seinen Lauf im 8. Jahrhundert v. Chr. (Jahre 800 bis 701).



Zu dieser Zeit gab es noch keine systematische Philosophie im Sinne von späteren Denkern wie Sokrates, Platon oder Aristoteles. Die klassische griechische Philosophie begann erst im 6. Jahrhundert v. Chr., (600 bis 501 v. Chr).
Jahr 594/93 – Solon, der Wegbereiter der Demokratie
Zur Zeit von Solon (ca. 640–560 v. Chr.) gab es noch keine systematische Philosophie im Sinne von späteren Denkern wie Sokrates, Platon oder Aristoteles. Die klassischen Philosophen wie Sokrates, Platon und Aristoteles entstehen im späten 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.. Solon war von keiner der klassischen Philosophien geprägt, jedoch Wissen aus der Zeit prägten sein menschliches Wesen:
- Weisheitstraditionen seiner Zeit, z. B. der sapientia der sogenannten „Sieben Weisen“ Griechenlands (zu denen Solon selbst gehört).
- Moralische und ethische Grundsätzen, die in den Werken von Dichtern wie Homer und Hesiod vermittelt wurden.
- Praktische Erfahrungen und Beobachtungen politischer und gesellschaftlicher Zustände in Athen und auf seinen Reisen (z. B. Ägypten, Lydien). Solon unternahm ausgedehnte Reisen: Er besuchte Ägypten, Lydien und möglicherweise auch Zypern. Auf diesen Reisen kam er mit östlicher und afrikanischer Weisheit in Berührung, die seine Auffassung von Gerechtigkeit, sozialer Organisation und Gesetzen beeinflusste. Platon berichtet in seinem Dialog Timaios sogar, dass Solon (in einer legendären Tradition) von ägyptischen Priestern lernte.
- Maximen wie „Mäßigung“ und „Gerechtigkeit“, die er in seinen Gesetzen und Gedichten formulierte. Solon war Dichter, Gesetzgeber und Politiker. Seine Gedichte behandelten moralische und soziale Themen. Er schrieb über die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen Arm und Reich, Gerechtigkeit als Grundlage sozialer Ordnung und Mäßigung als politische Tugend – und nahm damit das Konzept des „Maßstabs“ (métron) vorweg, das für die spätere griechische Ethik von wesentlicher Bedeutung war.
Wie es dazu kam, dass Solon die Demokratie erfand?
Im 5. Jahrhundert v. Chr. drohte Bürgerkrieg in Athen, weil eine soziale Krise lange Zeit nicht gelöst werden konnte. Athen war zwar wirtschaftlich sehr erfolgreich, aber es herrschte Korruption, Willkür der Adelsherrschaft, blutige Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft zwischen den verschiedenen Adelshäusern, etc.. All das hatte zur Folge, das die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer wurden, diese Situation traf besonders hart vor allem die durch Erb- und Schuldrecht rasch verarmenden Kleinbauern.
Die Adeligen begaben sich auf der Suche nach einem weisen Mann, dem sie die heikle Aufgabe des Ordnungs- und Friedensmachers anvertrauen konnten. Der Bürger Solon wurde, zum Archon (höchster Regierender) und Ins Amt des „Ins Lot-Bringer“ (ein Amt mit besonderer Funktion – keine Bezeichnung in Deutsch, auf verschiedene Weise übersetzt könnte als Schlichter oder Schiedsrichter und dazu mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattet, um sein Amt ausüber zu können) gewählt (im Jahr 594/93).
Solon selbst war ein Adliger, durch kaufmännische Arbeit erarbeitete er sich ein bescheidenes Vermögen, er war ein Mann der Mitte, der sich nicht auf die Seite einer Interessengruppe schlägt und als solcher hat er das Gemeinwesen neu geordnet, er hob die Schuldknechtschaft auf (Seisáchtheia), stellte sich gegen eine Neuverteilung des Bodens, führte neue Maße und Gewichte ein und gestaltete das Münzwesen neu, so dass das Recht, Münzen zu prägen, zum Monopol der öffentlichen Hand wurde. Die geltenden Gesetze ließ er auf öffentlich aufgestellten Säulen schriftlich festhalten. Die gesamte Bürgerschaft teilte er neu ein. Bestimmender Gesichtspunkt war nicht mehr die Herkunft, sondern die Größe des Vermögens, die Höhe des Ernteertrags oder des Geldeinkommens. Aus der Zugehörigkeit zu einer der vier Klassen — der pentakosiomedimnoi (derjenigen, die mindestens fünfhundert Maßeinheiten Weizen im Jahr besaßen), der hippei (Ritter, derjenigen, die sich ein Pferd leisten konnten), der Zeugiten (derjenigen, die eine Hoplitenausrüstung, die Ausstattung eines schwerbewaffneten Infanteriesoldaten, besaßen) und der Theten (der Besitzlosen) — leiteten sich die politischen Beteiligungsrechte und der Beitrag zum Kriegswesen her. In seiner Verfassungsreform schuf Solon zwei neue Organe: den Rat der Vierhundert (die bule) als Gegengewicht gegen den aristokratischen areopag und das Volksgericht, die heliaia, als Berufungsinstanz des Bürgers gegen Maßnahmen staatlicher Organe. Solon hat die althergebrachte Aristokratie des Erbadels ersetzt durch eine Timokratie, die Herrschaft der im Reichtum begründeten Ehre. Solon selbst nannte seine Verfassung eunomia („Wohlordnung“), die Herrschaft des von Menschen hervorgebrachten guten Gesetzes. Auch, wenn der Adel nicht entmachtet wurde, herrschte nun der Adel mit den Bürgern.
Solons Reformen legten den Grundstein für die Entwicklung der politischen Rechte der freien Bürger (eine frühe Form politischer Inklusion)
- Er schuf die rechtlichen und politischen Grundlagen, die später von Kleisthenes (Ende 6. Jh.) und Perikles (5. Jh.) zur eigentlichen Demokratie ausgebaut wurden.
- Solons Reformen begrenzten die Macht der Aristokratie und stärkten die Rechte aller freien Bürger.
- Er führte die Idee ein, dass Politik und Recht öffentlich und für alle Bürger zugänglich sein müssen.
- Damit begann die Entwicklung von Herrschaft durch das Volk (Demos + Kratos = Demokratie).
olon hat nicht die vollständige Demokratie erfunden, sondern wichtige Grundlagen gelegt, um die politische Macht in Athen zu öffnen und soziale Konflikte zu mildern. Seine Reformen sind der erste Schritt vom aristokratischen Herrschaftssystem hin zur Demokratie.
Von dieser Zeit an verbreitete sich in der gesamten region Griechenlanden die Idealen der Demokratien, deren Grundlage Solon geschaffen hat. Jedoch, andere Poleis hatten zwar demokratische Elemente, aber keine erreichten die institutionelle Ausgestaltung, den Einfluss auf die politische Philosophie und die historische Kontinuität, die Athen prägen. Deshalb steht Athen bis heute im Mittelpunkt des demokratischen Diskurses.
Die athenische Demokratie wurde zum Schlüsselbeispiel für das politische Denken der Aufklärung und der Moderne. Philosophen wie Montesquieu, Rousseau, Tocqueville bezogen sich auf Athen als Ursprung demokratischer Ideen. Moderne Demokratietheorien und -praktiken greifen oft auf die athenische Modell zurück.
508 bis 429 v.C.: Von Kleinsten bis Perikles, die Demokratie wurde vollkommener
Die politische Grundlage der attischen Polis hat Kleisthenes (570 – 507 v.C.) geschaffen. Vierzig Jahre nach seiner Reform wurde durch Perikles (um 495 – 429) die demokratische Ordnung Athens vollendet und zugleich der Adel endgültig entmachtet. Im Jahr 462 v.Chr. wurden auf Antrag des Perikles alle politischen Entscheidungen dem „Rat der Fünfhundert“, dem Volksgericht und der Volksversammlung (ekklesia) übertragen. Ein Jahr später wurde die Zahlung von Tagegeldern für Mitglieder des Rates und des Gerichtes eingeführt, um den ärmeren Mitbürgern den Zugang zu politischen Ämtern zu ermöglichen, die Bürger erhielten Theatergeld und Getreidespenden. Seiner Meinung nach konnten maßgebenden Überblick in der Politik nur diejenigen gewinnen, die keiner Tätigkeit nachzugehen hatten (er wollte damit auch den Vorteil der nicht arbeitenden Adelsmitglieder in der Bule abmildern). Schließlich wurden im Jahre 458 v.Chr. auch die Zeugiten, die dritte Klasse steuerpflichtiger Bürger, zu den höchsten Staatsämtern zugelassen. Auf dem Höhepunkt seiner Macht begann Perikles mit den finanziellen Mitteln der Bundesgenossen den prächtigen Ausbau der Akropolis. Er wirkte selbst in mehreren Baukommissionen mit und hatte intensiven Kontakt zu bekannten Wissenschaftlern und Künstlern, u. a. Pheidias, Sophokles, Herodot, Anaxagoras.
Damit war die Verfassung der Polis und zugleich das Vorbild aller demokratischen Verfassungen vollendet. An ihr orientieren sich die politische Philosophie der Griechen, insbesondere die Werke von Platon und Aristoteles. Unsere Demokratie rühmt sich, ihr Fundament hier zu haben. Pericles war so erfolgreich und beliebt, das er 15 Mal in Folge für jeweils ein Jahr zum Strategen der Stadt Athen gewählt wurde.
Perikles war der bedeutendste Staatsmann Athens, er ist von aristokratischer Herkunft und mütterlicherseits aus dem Geschlecht der Alkmaioniden, einem führenden attischen Adelsgeschlecht. Er war einer der Strategen (Feldherr) in einem gewählten Kollegium von zehn Strategen, das – unter täglich wechselndem Vorsitz – den Oberbefehl über Heer und Flotte innehatte. Ihre Amtszeit betrug ein Jahr, doch war die mehrmalige Wiederwahl möglich. Die Strategen gewannen sehr großen Einfluß auf die gesamte Politik und lenkten manchmal den Staat. Perikles ist der markanntes Beispiel dafür.“
Nach dem griechischen Historiker Thukydides war die Pentekontaetie, der rund fünfzigjährige Herrschaftszeitraum Perikles, die glänzendste Epoche der Geschichte Athens.
Auch, wenn der Weg der Demokratie von Solon bis Perikles von Tyrannei, Konflikte und Kriegen gesäumt war, es ist wichtig festzuhalten, dass es die Demokratie nur deshalb gibt und dieses hohe Niveau der individuellen Beteiligung und Verantwortlichkeit des Einzelnen für das Gemeinwesen erreicht wurde, weil jedes Individuum als die Grundlage des Gemeinwesen angesehen und aufgewertet wurde. Den Staat für die Stärkung des Individuums zu verpflichten, ist oberstes Gebot der Demokratie, ansonsten geht er die Gefahr ein, sich schleichend zu einer Pseudo-Demokratie zu entwickeln.
Wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Staat; nachlassende Motivation dabei, sich für den Staat einzusetzen; Politikverdrossenheit; Attraktivitätsverlust für qualifizierte Fachkräfte und Abwanderung der qualifizierten arbeitenden Klasse; Kapitalstarke Segmente bemächtigen sich der Politik und des Staates und Korruption im Staat sind einige schwerwiegende Konsequenzen aus der Vernachlässigung der Bürger auf Individuumsniveau durch den Staat.
——————————————————————————
Volkssouveränität und Solons Demokratie
Volksouveränität bedeutet: Die höchste Macht liegt beim Volk, also, das Volk entscheidet über Gesetze, Politik und Herrschaft. In Athen war dies eine der zentralen Grundideen der Demokratie, wenn auch in einem engen Sinn.
Umsetzung von Volkssouveränität in Athen
- Alle männlichen, volljährigen Bürger Athens durften direkt in der Ekklesia (Volksversammlung) mitbestimmen.
- Diese Versammlung konnte Gesetze erlassen, Beamte wählen und über Krieg und Frieden entscheiden.
- Das Volk hatte also direkte politische Macht, nicht nur repräsentative Kontrolle.
Einschränkungen der Volksouveränität in Athen
- Kein allgemeines Wahlrecht: Frauen, Sklaven, Metöken (Fremde) waren ausgeschlossen.
- Nur etwa 10-20 % der Gesamtbevölkerung Athens galten als „Bürger“ und waren stimmberechtigt.
- Dennoch wurde die Macht klar bei den Bürgern als Kollektiv angesiedelt.
Vergleich mit moderner Volksouveränität
- Heute versteht man Volksouveränität meist als Repräsentation durch gewählte Vertreter und universelles Wahlrecht.
- Athen praktizierte eine direkte Form der Volksmacht, die sich noch auf eine begrenzte Bürgergruppe beschränkte.
- Die athenische Volksouveränität war also partiell, aber dennoch revolutionär für ihre Zeit.